Gott im Leiden (1/2020)

Vom Aushalten der Sinnlosigkeit
Ich gebe zu, die Frage, warum Gott das Leid in der Welt zulässt, hat sich mir nie wirklich gestellt. Ich bin zu pietistisch dafür aufgewachsen. Im Pietismus, wie ich ihn erlebt habe, gilt es als anmaßend, Gott zu hinterfragen. Nicht Gott hat sich vor dem Menschen zu rechtfertigen, sondern der Mensch vor Gott. Gottes Wege sind unergründlich. Wer bin ich kleiner Mensch, dass ich mich zum Richter über den allmächtigen Gott aufspiele?
Dennoch war ich mit der sogenannten „Theodizeefrage“ bereits in der Schulzeit konfrontiert, meist aus dem Munde meiner Mitschülerinnen. Wie kann ein liebender und allmächtiger Gott das Leiden in der Welt nicht verhindern? Kann er es etwa nicht oder will er es bloß nicht? Und wenn er es will und kann, wie lässt es sich dann erklären?
Für uns war dies keine rein philosophische Frage, sondern wurde ganz konkret: Warum musste die Mutter meiner Klassenkameradin an Krebs sterben? Hätte Gott das nicht verhindern können? Und wie kann ein liebender Gott zulassen, dass die Kinder am anderen Ende der Welt, für die wir am Weihnachtsbasar Geld sammeln, so lange alleine auf der Straße leben mussten? Wie sah es mit den Menschen aus, die gerade im World Trade Center arbeiteten, als zwei Flugzeuge sie zum Einstürzen brachten? Natürlich war uns allen klar, dass sehr viel Leid in dieser Welt menschengemacht war. Nicht Gott verübte Gewalttaten oder rief zum Krieg, sondern einzelne Menschen waren dafür verantwortlich. Trotzdem trafen die Folgen dieses Handelns immer wieder Unbeteiligte und gerade bei den Krankheits- und Todesfällen genügte uns diese Erklärung nicht.
Die beste aller möglichen Welten?
Im Religionsunterricht diskutierten wir schließlich mit unserer Lehrerin und setzten uns mit verschiedenen Ansätzen auseinander. Immerhin haben sich schon viele Menschen im Lauf der Zeit Gedanken zu dieser Frage gemacht. Manche versuchten, im Leiden einen größeren, göttlichen Sinn zu erkennen; zum Beispiel der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz. Er ging davon aus, dass Gott unter einer unendlicher Anzahl möglicher Welten nur eine geschaffen habe, nämlich die vollkommenste, „die beste aller möglichen Welten“. Mit dieser Idee konnte Gott sowohl Allmacht als auch Allgüte als Eigenschaften behalten und jede Form des Übels in der Welt war letztlich notwendig und erklärbar. Bei meinen Mitschülerinnen und mir hingegen fiel die Idee kollektiv durch: Wie schon der Philosoph Bertrand Russel konnte ich es kaum glauben, dass unsere Welt mit all ihrem Elend tatsächlich das Beste sein sollte, was einem liebenden und allmächtigen Gott so einfallen konnte.
Gott als Erzieher?
Gemischte Gefühle empfand ich bei dem Gedanken von Gotthold Ephraim Lessing, dass Gott als Erzieher der Menschen auftrete und auch alles Leiden in dieser Welt dazu dienen solle, den Menschen zum Guten und zur Vernunft zu führen. Einerseits sah ich den „erzieherischen“ Effekt, den persönliche Leiderfahrungen haben konnten: Wenn ich selbst in der Schule gehänselt worden war, würde ich mich in Zukunft möglicherweise eher für schwächere Mitschüler einsetzen. Oder wenn ich einen Menschen bei einem Verkehrsunfall verloren hatte, würde ich selbst vielleicht vorsichtiger Auto fahren. Doch es dauerte nicht lange, da kam dieses Konzept an seine Grenzen: Welcher „Erziehungseffekt“ konnte rechtfertigen, dass einem Kind Gewalt angetan wurde? Die Idee, dass dieses Kind sich später als ein achtsamer Pazifist erfolgreich für Völkerverständigung und Frieden in der Welt einsetzen würde, erschien mir zynisch und ignorant.
Gott als Erzieher zu sehen, der uns durch Leidsituationen trainieren möchte – hier kann ich nicht mitgehen. Überhaupt fiel mir auf, dass jeder Ansatz, der im Leiden selbst einen Sinn finden wollte, mir nicht genügte. Es musste doch auch als gläubiger Mensch möglich sein, die Sinnlosigkeit des Leidens anzuerkennen!
„Viel lieber will ich meinen Sohn zurück!“
Zu Hilfe eilte mir schließlich ein kleines Büchlein des amerikanischen Rabbis Harold Kushner: „Wenn guten Menschen Böses widerfährt“. Kushner hatte seinen Sohn bei einem Autounfall verloren und konnte die Trauer und den Schmerz darüber kaum ertragen. In dieser schweren Zeit, voller Selbstmitleid und Zorn, standen ihm viele Menschen aus seiner Gemeinde und Nachbarschaft bei. Schließlich konnte er an sich selbst beobachten, dass er nach dem Tod seines Sohnes weicher und mitfühlender geworden war. Kushner erkannte letztlich Gottes Wirken in all diesen Folgen des tragischen Unglücks. Er fragte nicht mehr: „Warum geschah mir das?“, sondern „Was kann ich, da mir solches widerfahren ist, jetzt tun?“
Was mich an seiner Geschichte besonders ansprach, war seine Feststellung, dass er all die guten Dinge, die er nach dem Tod seines Sohnes erlebt hatte – sowohl die liebevolle Anteilnahme der Freunde als auch die eigene persönliche Entwicklung – sofort wieder eintauschen würde, wenn er seinen Sohn dafür zurückhaben könnte. Egal, wie positiv die Auswirkungen sind, die eine Leidsituation haben kann, bei Kushner rechtfertigen sie niemals das Leiden als solches!
Kushner eröffnete mir damit eine Möglichkeit, Gott auch im Leiden zu entdecken und zu begegnen – zum Beispiel in den Momenten, in denen Gottes Liebe in der Liebe und Zuwendung der anderen für mich spürbar wird. Dieser Blick half mir über viele Jahre hinweg, mit schwierigen und leidvollen Situationen umzugehen. Als ich beispielsweise meine Heimatgemeinde über einem Konflikt verließ und mich sehr alleine fühlte, fand ich eine andere Gruppe, in der Menschen mich herzlich willkommen hießen. In ihrer Freundlichkeit und Herzlichkeit konnte ich Gott erkennen, der mich nicht alleine ließ und bei dem ich jederzeit willkommen war.
Wenn all die kleinen Gesten nicht mehr reichen
Letztes Jahr geriet leider auch dieser Ansatz bei mir ins Wanken. Ich hatte innerhalb von eineinhalb Jahren eine solche Menge an Tod und Verlusterfahrungen erlebt, dass mir all die kleinen Gesten, in denen ich Gott so oft erkannt hatte, nicht mehr reichten. Besonders zwei Suizidfälle konfrontierten mich damit, dass es eben doch nicht immer gelingt, im Leben wieder Mut und Hoffnung zu fassen, sondern dass auch kluge, wertvolle, geliebte Menschen unter bestimmten Umständen keinen Weg mehr für sich finden und an diesem Leben verzweifeln. Außerdem litt ich daran, dass wir als Christ:innen an so vielen Orten weltweit die etablierten Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen aufrechterhalten und stärken – und noch dazu in unseren eigenen Gemeinden, in dem, was doch lebendiger Leib Christi sein sollte, ebenfalls ein Gebäude von Macht und Machtmissbrauch aufgebaut hatten.
Ich ließ mir eine Woche lang auf Borkum den Wind durch die Haare pusten und fragte mich, ob es das nun war mit meinem Glauben. Mein Glaube an die kleinen, unscheinbaren Aufbrüche, an das Reich Gottes, das so winzig ist wie ein Senfkorn, an die durch Herzen und lustige Figuren übermalten Hakenkreuze, an den Löwenzahn, der auch den härtesten Asphalt durchbricht, an die vom Einzelnen ausgehende Veränderung – was auch immer ich früher als Trost erlebt hatte, worin ich meine Hoffnung gesetzt hatte und was für mich so stark Ausdruck von Gottes Wesen geworden war, half nicht mehr. Ich drohte am Leid zu ersticken und jeder Versuch der Besänftigung machte mich nur unglaublich wütend.
Ein leidender, ohnmächtiger Gott
Bei einem Spaziergang am Strand schleuderte ich der ganzen Welt mein Leiden an ihr entgegen. Egal, wie zugewandt und verständnisvoll alle waren, in meinem Schmerz fühlte ich mich dennoch nicht verstanden. Plötzlich hatte ich eine Art Offenbarung – oder vielleicht waren es auch nur innere Puzzleteile, die sich nun zusammensetzten: In Jesus habe ich einen leidenden Gott, der an genau den gleichen Dingen in dieser Welt sogar so leidet, dass er stirbt. Diese Erkenntnis war für mich in dem Moment der wohl größte Trost, den die Ewige mir zukommen lassen konnte. Ich bin in Jesu Leiden und Ohnmacht mit meinem eigenen Leiden und meiner eigenen Ohnmacht aufgehoben. Ich habe in ihm einen Gott, der das Leiden mit mir aushält. Und er muss nicht einmal meinen Schmerz verstehen, es reicht mir völlig, dass er selbst gelitten hat.
Als Überlebender des Holocaust erzählt Elie Wiesel von einer Situation im Konzentrationslager, in der drei Menschen von der SS erhängt wurden, darunter ein Kind. Hinter ihm fragte jemand angesichts des grausamen Todeskampfes: „Wo ist Gott?“ Elie Wiesel schreibt, dass eine Stimme in ihm antwortete: „Wo er ist? Dort – dort hängt er, am Galgen …“
Auch diese Geschichte hatten wir im Religionsunterricht besprochen und sie war eindrücklich genug, dass ich mich bis heute an sie erinnere. Dennoch hatte sie mir nicht so viel Trost gegeben wie der Blick nach vorne, der sich bei Kushner für mich auftat. Heute kann ich sagen: Es gibt Momente, in denen wir nicht über das Leiden hinausblicken können und sich jeder Trost nur schal und flach anfühlt. In Jesus einen leidenden, ohnmächtigen Gott zu haben, kann in dieser Situation helfen, die Sinnlosigkeit des Leidens auszuhalten.
Ihr habt mich abgehängt. Ich leide
nicht am Untergang der Welt.
An Herzen, die nicht mehr schlagen,
leide ich, an Einsamkeit, die überhand nahm,
und am Verstummen.
Du Ewige, leuchte mir den Weg.
Jaana Espenlaub (33) ist Diplomtheologin und Germanistin. Sie lebt alleine in Fellbach bei Stuttgart und wünscht sich einen Glauben und eine Theologie, die den leidenden Gott nie aus dem Blick verliert.
Die neue Ausgabe der Korrekten Bande ist wie gewohnt im Kultshop (als Print oder PDF) erhältlich oder natürlich direkt als Abo.
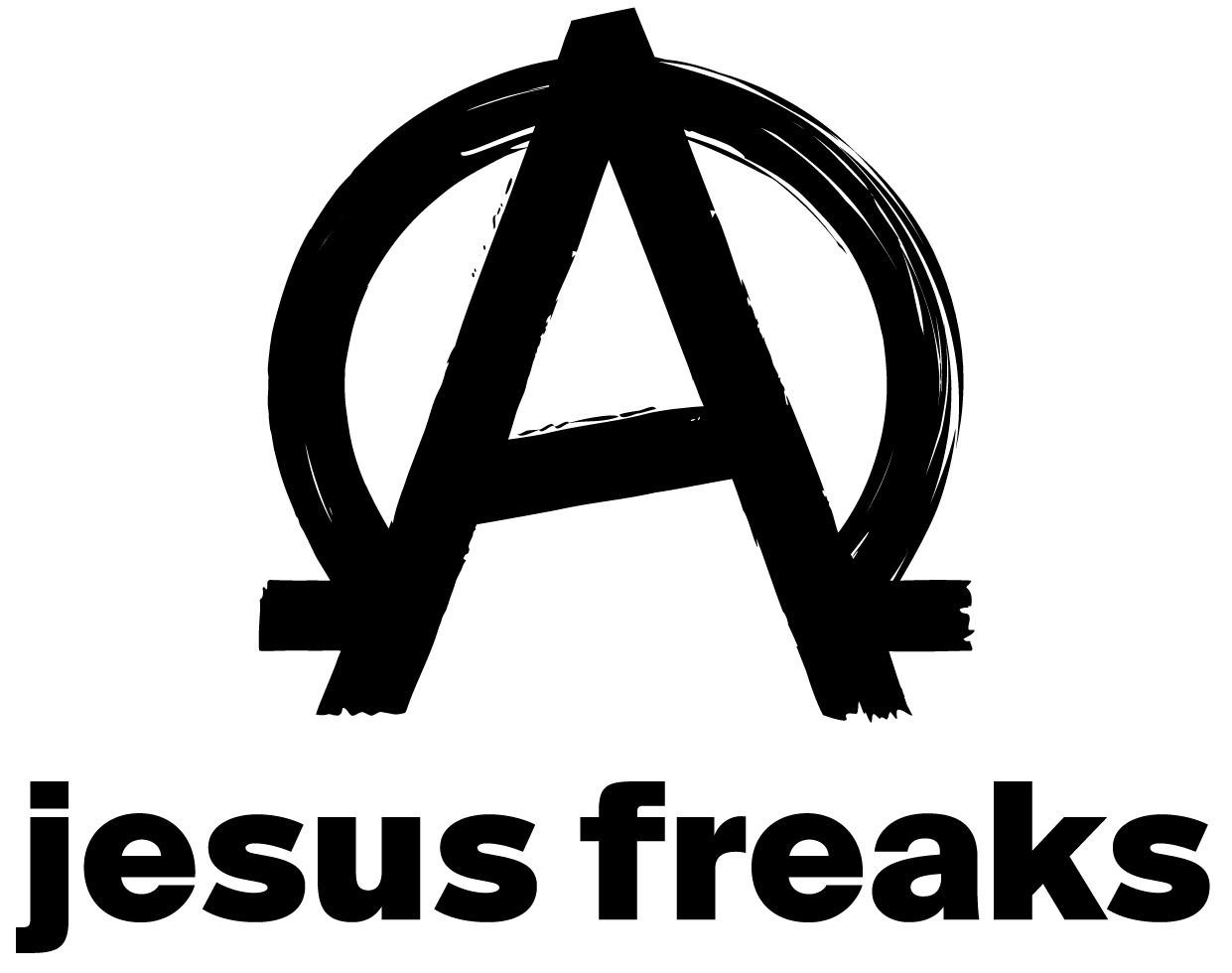

Hallo Jaana,
danke, dass du deine Gedanken mitgeteilt hast. Bis zu dem Satz: „Ich drohte am Leid zu ersticken und jeder Versuch der Besänftigung machte mich nur unglaublich wütend“ konnte ich deinen „Werdegang“ sehr gut nachvollziehen und mich darin wiederfinden. Der letzte Abschnitt funktioniert für mich persönlich nicht. In dem mitleidenden Gott finde ich keinen Trost. Ich habe meinen Glauben verloren. Ob das schlimm ist, weiß ich noch nicht. Ich empfinde es als einen Prozess permanenter Desillusionierung, an den ich mich immer irgendwie hinterhergewöhnen muss. Ich will niemanden seinen Glauben wegnehmen. Ich bewundere und beneide ein wenig die Menschen, für die er noch funktioniert und die in ihm Trost und Halt finden. Es ist für mich doch auch eine schmerzhafte Verlusterfahrung, ich fühle mich orientierungs- und ziellos. Alles hat seinen Wert verloren. Alles ist banal geworden. Es gibt kein oben und unten mehr, keinen Sinn. Am schwersten ist es für mich, da ich Vater bin und meinem Kind gefühlt „nichts“ mit auf dem Weg geben kann. Gerade habe ich einfach nur zu kämpfen, nicht unterzugehen. Es ist eine harte Lernerfahrung, ein ganz harter Weg. Gegenüber Besänftigungen empfinde ich keine Wut mehr. Ich kann die Besänftiger verstehen. Man will helfen, man will seine eigene funktionierende Welt retten. Vielleicht ist das ja gesund. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die sich leichter illusionieren können, besser durchs Leben kommen. Ich habe diese Fähigkeit verloren.
Ich wünsche dir alles Gute, W.
Lieber W.,
vielen Dank für deine persönliche Antwort. Es ist wohltuend, irgendwie verstanden zu werden. Ich teile deine Empfindung, dass „Menschen, die sich leichter illusionieren können, besser durchs Leben kommen.“ Dieses Gefühl hatte ich auch sehr oft. Zu meinem letzten Abschnitt möchte ich gern ergänzen, dass es mir weniger um einen mitleidenden Gott, sondern um einen leidenden Gott geht. Ich habe das Gefühl, ein Mitleiden Gottes an meinem Leiden würde mir nicht genügen. Der Fokus für mich ist das eigene Leiden Jesu an der Welt, den Menschen. Das konnte ihm auch keiner abnehmen. Ich denke manchmal, Gott ist genauso an der Welt gescheitert wie wir. Gerade der Karsamstag bedeutet mir daher viel. Jesus ist tot. Wie geht es jetzt weiter? Das Vertrauen darauf, dass ich ebenso einen Prozess erleben darf, der zur Auferstehung, zur Überwindung des Todes führt, gibt mir Kraft. Es ist aber immer auch rätselhaft für mich, verschwommen, unklar, wie und ob dies passiert.
Was du von deinem Leben beschreibst, klingt hart. Ich will dir in dieser Situation gar nichts wünschen, sondern sie zumindest für den Moment, in dem ich diese Antwort schreibe, aushalten. Und dann wünsche ich dir natürlich trotzdem, dass etwas in dein Leben kommt, was es hell und leicht macht. Ich glaube, wir wünschen uns das alle.
Sei herzlich gegrüßt
Jaana