Eine Ärztin für 20.000 Menschen (5/18)
Arbeit auf einer Dorfgesundheitsstation in Tansania
Es ist Freitagabend und Amina, eine zierliche, ältere Dame humpelt an mir vorbei in den Operationssaal. Sie hat nur ein OP-Tuch umgeschlungen. Sie hat einen übelriechenden Tumor auf dem rechten Fußrücken. Dreimal sei er schon erfolglos in anderen Krankenhäusern operiert worden. Der Hauttumor ist ein Riesenzellkarzinom, welches zwar nicht in den Körper streut, aber lokal zerstörend in das umliegende Gewebe wächst. Wir hatten die Patientin darauf vorbereitet, dass wir eventuell den Fuß teilweise amputieren müssten. Sie willigte zögernd ein. Wir versprachen, erst zu sehen, was wir auch ohne Amputation erreichen könnten.
Auch dieser OP-Tag ist wieder lang. Zur Prostata-Entfernung, zwei Gebärmutter-Entfernungen und zwei Leistenbrüchen waren ungeplant eine Bauchhöhlen-Schwangerschaft und zwei Kaiserschnitte gekommen. Ein Patient konnte nicht operiert werden, da keine Blutspenden zur Verfügung standen. Nach Blutgruppen- und HIV-Testung übernehmen das hier die Angehörigen. Diese Woche hatte ich meine erste Malaria durchgemacht, als ich noch etwas k.o., in die Klinik ging. Ab 20 Uhr arbeitet nur noch eine Schwester im OP und das Programm war noch lange nicht geschafft. Auch am nächsten Tag wäre außer meiner Chefärztin und mir niemand da, um verschobene Operationen aufzuarbeiten. In Deutschland kommen auf 1000 Patienten 6 Ärzte, in Tansania auf 20.000 Menschen ein Arzt.
Meine Chefin dokumentiert ihren letzten Eingriff, während Amina auf den OP-Tisch klettert. Sie wirkt zerbrechlich und wiegt gerade mal 41 kg. Die OP-Schwester verabreicht die Narkosemedikamente. Anästhesisten oder »Instrumentier-Schwestern« gibt es nicht. Ich unterstütze die leitende Ärztin in ihrer Arbeit, damit sie mehr Zeit für ihre Aufgaben als Klinikdirektorin hat. Es fällt mir schwer, mich auf tansanische Verhältnisse umzustellen. Das Missionskrankenhaus, in dem wir arbeiten, hat von staatlicher Seite den Status einer Dorfgesundheitsstation und erhält Zuschüsse. Es ist über die Jahre auf 120 Betten und 130 einheimische Angestellte angewachsen. Es hat sich herumgesprochen, dass hier gut operiert wird. Menschen kommen teilweise aus dem benachbarten Burundi oder 1.200 km weit aus der Hauptstadt Daressalam. Der Fischer eine Daniel hatte zwei Tagesreisen benötigt, um hierher zu kommen. Er war von einem Krokodil angegriffen worden, das seine rechte Hand weitgehend vom Unterarm abgetrennt hatte. Wir konnten nur noch amputieren.
Vor Aminas OP betet die Schwester auf Kiswahili, der offiziellen Landessprache, um Gottes Schutz und Hilfe. Viele Einheimische sprechen primär ihre Stammessprache Kiha, so dass die Krankenschwestern dann übersetzen. Amina erhält Narkosemittel, welches sie schmerzfrei schlafen lässt, aber Atmung und Schutzreflexe nicht dämpft. Der faulende Tumor zerfällt schon zu Beginn der OP. Wir entscheiden uns, in den nächsten Tagen eine Vorfußamputation mit entsprechendem Sicherheitsabstand zum Tumor durchzuführen und es in dieser Nacht bei der Entfernung des direkt betroffenen Gewebes zu belassen. Mit einer ausreichenden Dosis Schmerzmittel wird Amina zurück auf die Station gebracht, wo Angehörige ihre Betreuung und weitere Pflege übernehmen. Die Schwestern sind für Verbandswechsel, regelmäßige Kontrollen oder auch Verabreichung der Medikamente zuständig.
Nach einer weiteren kleinen OP verlasse ich um halb elf nachts den Saal und mache mich auf den Weg zur chirurgischen Visite. Die leitende Ärztin ist inzwischen völlig erschöpft nach Hause gegangen. Im Innenhof läuft ein Fernseher für Patienten und Angehörige und fröhliche Musik erfüllt die laue Nachtluft. »Ich mag diese Menschen«, geht es mir wieder einmal durch den Kopf. In den Zimmern brennt noch schwaches Licht, als ich die Patienten unter ihren Moskitonetzen nach dem Befinden frage. Auf dem Fußboden haben sich Angehörige schlafen gelegt. Niemand ist verärgert über die späte Störung durch die Daktari.
Viele Therapie-Optionen scheitern daran, dass sich Patienten weder die Fahrt zur entsprechenden Einrichtung noch die Behandlung selbst leisten können. Krankenversicherungen gibt es zwar, die Kosten sind aber für die arme Landbevölkerung kaum aufzubringen. Eine staatliche Kostenübernahme gibt es zumindest für Malaria, HIV, Tuberkulose und Familienplanung.
Was hatte ich mir eigentlich vorgestellt, als ich aus Deutschland aufgebrochen war, um eine fremde Sprache zu lernen und in eine fremde Kultur einzutauchen und um zunächst mal für ein Jahr Menschen zu helfen, die nicht mit Bildung und Wohlstand gesegnet sind wie wir in unserer Kultur? Durch das Deutsche Missionsärzte-Team (ww.dmaet.de) war ich auf die Kultur und Denkweise der Menschen vorbereitet worden. Was mich hier allerdings an einem breiten Spektrum der Medizin erwartete, die mit einfachsten Mitteln qualifiziert umgesetzt wird, auch wenn man so oft an die Grenzen der Möglichkeiten stößt, damit hatte ich nicht gerechnet.
Wer Beate weiter durch den Einsatz begleiten möchte, kann ihren Newsletter anfordern: ↗ . Alle ein bis zwei Monate versendet sie eine Mischung aus persönlichen Infos, Medizinischem und Kultur.
—
… du möchtest die ganze Ausgabe lesen?
Dann hol dir dein Heft über den Kultshop (als Print oder PDF) oder schließ direkt ein Abo ab!
—
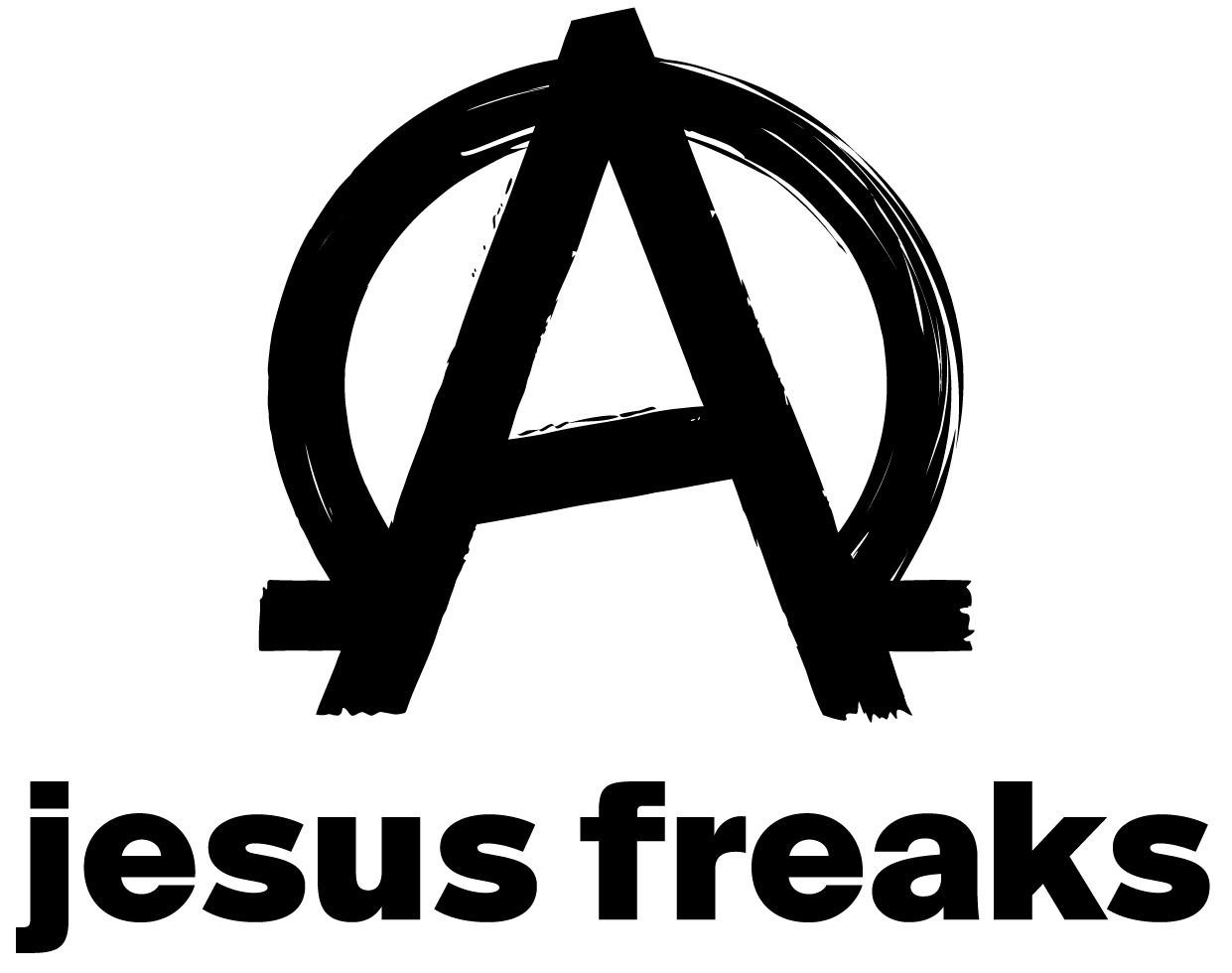



Ein Kommentar