Weichmacher im Herz (4/19)

Gerechtigkeit klingt nach einem abgeklärten Begriff. Dabei ist sie höchst leidenschaftlich. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist: Leiden wir als Christen noch an der Ungerechtigkeit in der Welt? Und wie gehen wir damit um?
Das Thema Soziale Gerechtigkeit treibt mich schon mehr als die Hälfte meines Lebens um. Schon früh habe ich mich gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass einige wenige so viel mehr haben als sie jemals brauchen können, während andere ein Leben in Armut und Hunger führen, ohne auch nur den Hauch einer Chance zu haben, jemals etwas an ihrer Situation zu ändern. Dabei ist doch eigentlich genug für alle da und die Ideale der globalen Gerechtigkeit sind mehr als nur ein sozialistischer Sommertraum. Gerade in der Bibel finden wir sehr viele Ideen, wie ein gemeinschaftliches und kooperatives Zusammenleben gestaltet werden kann.
Empfinden wir noch die Sehnsucht danach, dass diese Welt ganz anders aussehen könnte?
Eine Welt, in der Kinder überall die gleichen Startchancen ins Leben haben. In der die Reichen nicht auf Kosten der Armen leben. In der alle vom Frieden profitieren, statt wenige vom Krieg.
Das Streben nach Gerechtigkeit ist nunmal keine abgeklärte juristische Formalie, denn es setzt eine mitfühlende, mit-leidende Herzenshaltung voraus. Nur wenn ich mein Herz für mein leidendes Gegenüber öffne, kann ich mich mit ihm identifizieren. Erst aus diesem Leiden heraus kann unser Mut, für Gerechtigkeit zu streiten, richtig Feuer fangen.
Fulbert Steffensky schreibt in seinem Text Was unsere Hoffnung nährt:
„Mut setzt Sympathie voraus, Mut setzt Menschenliebe voraus. Der Mut verliert seinen Boden, wo Menschen oder eine Gesellschaft apathisch wird, also die Fähigkeit verliert, etwas zu lieben, an etwas zu leiden und etwas zu vermissen. Wo man die Sprache der Stummen nicht mehr vermisst, das Brot der Armen und das Lebensrecht der Geflüchteten, da wird man auch keinen Mut aufbringen, daran zu arbeiten. Es gibt narkotische Gesellschaften und Lagen, in denen Menschen in der Selbstbetäubung verharren und die Gefahr für die Zukunft nicht wahrnehmen, sie jedenfalls nicht als die eigene Sache wahrnehmen.“
Für mich hatte Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit schon immer eine starke emotionale Komponente. Wenn ich mich dem Leid in meiner kleinen Welt um mich herum oder gar der ganzen großen Welt öffne, bricht es mir fast das Herz: ich leide an meiner eigenen Unfähigkeit mich nicht zu den Obdachlosen neben dem Bahnhof zu setzen, ihnen zu zeigen, dass ich sie als Menschen wahrnehme, und ihnen zu helfen. Es jammert mich, wenn ich Berichte über die Lager in den USA sehe, in denen Flüchtlingskindern, von ihren Eltern getrennt, grundlegende Menschenrechte verwehrt werden. Oder wenn ich sehe, wie Menschen, die über das Mittelmeer geflüchtet sind, weil sie verfolgt werden oder ihnen die Lebensgrundlage durch gierige Konzerne und korrupte Politiker entzogen wurde zum machttaktischen Spielball nationalistischer Regierungen werden. Und wenn ich den Hass bemerke, den hier Geborene ihnen in den Kommentarspalten und Sozialen Medien entgegenschreien. Ich werde wütend, wenn ich über die willkürliche Polizeigewalt in Hong Kong oder Istanbul lese.
Gerechtigkeit heißt nicht Rechtmäßigkeit
Gerade in ungerechten Systemen neigen Kämpfer*innen für Gerechtigkeit dazu, sich im Widerspruch zur gängigen Rechtspraxis und bestehenden Gesetzen zu befinden. Da müssen wir uns nicht einmal in die Vergangenheit der Deutschen Geschichte begeben oder mit dem Unerwünschten Nr. 1 durch die Zaubererwelt schlagen. Es reicht ein Blick auf die sich verschärfenden Polizei- und Sicherheitsgesetze, die in den letzten 2 Jahren diverse Landesparlamente durchlaufen haben. Und manchmal frage ich mich, wie viele Wahlen es letztendlich dauert, bis ich mich auf einmal auf der falschen Seite der Rechtsprechung wiederfinde.
Und in all dem Erkennen des ungerechten Ist-Zustandes und wie rechtmäßige Ungerechtigkeit geschützt wird, habe ich mich auch schon mehr als einmal in einem wütenden Demo-Block wiedergefunden, der mit der Polizei nicht den richtigen Adressaten für seinen Unmut gewählt hat. Deshalb will und muss ich in all dem Streben und Sehnen nach Gerechtigkeit und dem Kämpfen für mein Verständnis von Gerechtigkeit hinterfragbar bleiben. Ich weiß, dass ich in allem nur der Weisheit vor-letzten Schluss kenne. Dass ich fehlbar bin und über das Ziel hinausschieße.
Selbst-Gerechtigkeit ist kein wirklich erfolgversprechendes Konzept, wenn man mit Jesus unterwegs sein möchte. Im Gegenteil: er stellt uns und unserem Verhalten immer wieder aufs Neue seinen Maximen (Mt 7,12, Mt 25,40) gegenüber. Jesus stellt mich, mein Handeln und meine Herzenshaltung in Frage und zeigt mir zugleich, dass ich das alles gar nicht erfüllen kann und ihn eben doch brauche.
Zwei Gefühle reißen an mir: die leidenschaftliche, manchmal zornige und oft traurige Sehnsucht nach einer anderen, einer gerechteren Welt und das Gefühl der Überforderung, wenn ich mich dem Leid und dem Unrecht in der Welt tatsächlich aussetze.
Und ich habe keine Idee, ob und wie ich – wie wir damit fertig werden. Aber ich bin der Überzeugung, dass Gott uns dazu ermutigt, anzufangen – im Vertrauen darauf, dass mein zaghaftes, fehlbares Losgehen nur ein kleiner Teil der Wegstrecke ist, auf einem Weg, den er vollenden wird.
Ben Gross lebt mit seiner Familie in Berlin und hat immer viel zu wenig Zeit in der Politik für Gerechtigkeit zu kämpfen. Dafür tanzt er nicht nur gerne auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig, sondern fotografiert diese auch noch.
… du möchtest die ganze Ausgabe lesen?
Dann hol dir dein Heft über den Kultshop (als Print oder PDF) oder schließ direkt ein Abo ab!
Photo by Leon Bublitz on Unsplash
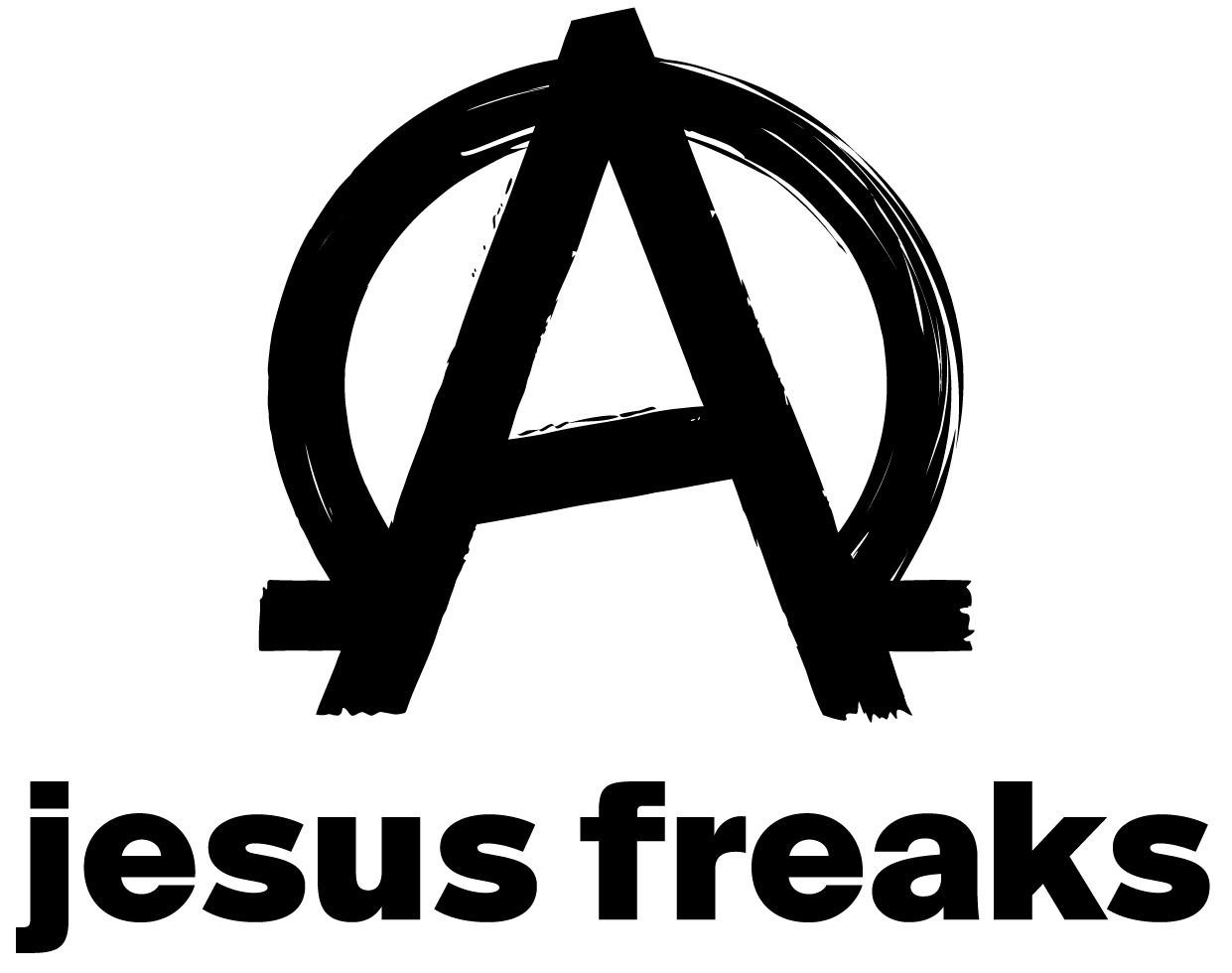

Ein Kommentar